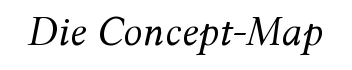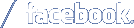110 Beziehungen: Aderhaut, Adherens Junction, Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen, Anus, Basalmembran, Basalzelle, Bauchfell, Bauchspeicheldrüse, Becherzelle, Bindegewebe, Bindehaut, Biologie, Blättermagen, Blut-Augen-Schranke, Blut-Hirn-Schranke, Blutgefäß, Brunner-Drüsen, Corpus ciliare, Crusta (Biologie), Cytoskelett, Darmschleimhaut, Desmosom, Drüse, Eierstock, Eileiter, Emperipolesis, Endothel, Epidermis (Wirbeltiere), Epithelisierung, Eustachi-Röhre, Exkretion, Exozytose, Extrazelluläre Matrix, Flimmerepithel, Galle, Gallenblase, Gelenkkapsel, Geschmacksknospe, Gewebe (Biologie), Glandula submandibularis, Haarzelle, Harnblase, Harnleiter, Harnröhre, Hemidesmosom, Herzbeutel, Histologie, Hodenkanälchen, Hornhaut, Hypophyse, ..., Kapillare (Anatomie), Kolloid, Luftröhre, Lumen (Biologie), Lungenbläschen, Lysosom, Magenschleimhaut, Makropinozytose, Mechanorezeptoren der Haut, Melanine, Membran (Trennschicht), Merkel-Zelle, Mikroplicae, Mikrovilli, Milchdrüse, Mundhöhle, Muskulatur, Nebenhoden, Nervengewebe, Netzhaut, Netzmagen, Neuroepithel, Nierenbecken, Ohrspeicheldrüse, Ovarialfollikel, Pansen, Phagocytose, Pleura, Prostata, Resorption, Rezeptorzelle, Riechschleimhaut, Samenleiter, Schilddrüse, Schleimbeutel, Schweißdrüse, Sekretion, Speicheldrüse, Speiseröhre, Stammzelle, Swiss Institute of Bioinformatics, Talgdrüse, Tight Junction, Transport (Biologie), Transporter (Membranprotein), Tränendrüse, Tubulus, Tunica serosa, Urin, Urothel, Ussing-Kammer, Vagina des Menschen, Verhornung, Vielzeller, Würfel (Geometrie), Zelle (Biologie), Zellkern, Zellkontakt, Zellpolarität, Zwölffingerdarm. Erweitern Sie Index (60 mehr) »
Aderhaut
Schema eines Horizontalschnitts durch Augapfel und Sehnerv:1. Lederhaut (Sclera)'''2. Aderhaut (''Choroidea'')'''3. Schlemm-Kanal (''Sinus venosus sclerae'')4. Arterieller Gefäßring (''Circulus arteriosus iridis major'')5. Hornhaut (''Cornea'')6. Regenbogenhaut (''Iris'')7. Pupille (''Pupilla'')8. vordere Augenkammer (''Camera anterior bulbi'')9. hintere Augenkammer (''Camera posterior bulbi'')10. Ziliarkörper (''Corpus ciliare'')11. Linse (''Lens'')12. Glaskörper (''Corpus vitreum'')13. Netzhaut (''Retina'') und Pigmentepithel14. Sehnerv (''Nervus opticus'')15. Zonulafasern (''Fibrae zonulares'')16. Gefäßversorgung (''Vasa ophthalmicae'')Äußere Augenhaut (''Tunica externa bulbi''): 1. + 5.Mittlere Augenhaut (''Tunica media bulbi''): 2. + 6. + 10.Innere Augenhaut (''Tunica interna bulbi''): 13. Die Aderhaut, auch Choroidea oder Chorioidea genannt, ist der größte Abschnitt der mittleren Augenhaut (Tunica media bulbi).
Neu!!: Epithel und Aderhaut · Mehr sehen »
Adherens Junction
Interaktionen von strukturellen Proteinen an einer ''Adherens Junction''. Man sieht wie die Cadherine über verschiedene andere Proteine zu den Aktinfilamenten verbunden sind. Unter dem Begriff Adherens Junctions wird eine Gruppe von Adhäsionsverbindungen (engl.: Adhering junctions) zusammengefasst.
Neu!!: Epithel und Adherens Junction · Mehr sehen »
Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
Die anatomischen Ebenen Die Lage- und Richtungsbezeichnungen des Körpers der meisten Gewebetiere (inklusive des Menschen) dienen in der Anatomie zur Beschreibung der Position (situs), der Lage (versio) und des Verlaufs einzelner Strukturen.
Neu!!: Epithel und Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen · Mehr sehen »
Anus
''Raphe perinei'', unten im Bild die Unterseite des Penis hinter dem Hodensack Scheideneingangs Der Anus, (eigentlich „Hinterer“; substantiviert von „hinter, nachfolgend“), umgangssprachlich auch das Poloch, die Rosette oder Poperze genannt, ist die Austrittsöffnung des Darmkanals von Menschen sowie vielzelliger Tiere.
Neu!!: Epithel und Anus · Mehr sehen »
Basalmembran
Die Basalmembran, schematische Darstellung. ''lm'' lichtmikroskopisch, ''em'' nur elektronenmikroskopisch erkennbar Als Basalmembran bezeichnet man eine lichtmikroskopisch erkennbare Schicht retikulärer, argyrophiler Fibrillen und Fasern, die infolge ihres Gehaltes an Glykoproteinen PAS-positiv ist.
Neu!!: Epithel und Basalmembran · Mehr sehen »
Basalzelle
Als Basalzellen bezeichnet man Zellen, welche in tiefen Zellschichten von Epithelien auf oder in der Nähe der Basalmembran ruhen.
Neu!!: Epithel und Basalzelle · Mehr sehen »
Bauchfell
Das Bauchfell oder Peritoneum (älter auch Peritonaeum, von; davon abgeleitet bereits bei Hippokrates speziell) kleidet als glatte, durchsichtige und seröse Haut den Bauchraum und darin liegende Organe aus.
Neu!!: Epithel und Bauchfell · Mehr sehen »
Bauchspeicheldrüse
Die Bauchspeicheldrüse – fachsprachlich auch das Pankreas (latinisiert auch Pancreas, von griechisch: πάγκρεας, pánkreas, von πᾶν pân für „alles, ganz“, und κρέας kréas für „Fleisch“) – ist ein quer im Oberbauch hinter dem Magen liegendes Drüsenorgan der Wirbeltiere.
Neu!!: Epithel und Bauchspeicheldrüse · Mehr sehen »
Becherzelle
Raues ER Golgi-Apparat Zellkern Die Becherzelle, auch Goblet-Zelle (von, „Becher“) genannt, ist eine einzellige, becherförmige, Schleim produzierende Drüse, die innerhalb eines Epithelverbands liegt.
Neu!!: Epithel und Becherzelle · Mehr sehen »
Bindegewebe
Bindegewebe bezeichnet verschiedene Gewebetypen, die in allen Bereichen des Körpers vorkommen und dort vielfältige unterstützende Aufgaben verrichten.
Neu!!: Epithel und Bindegewebe · Mehr sehen »
Bindehaut
Die Bindehaut überzieht die hintere, dem Augapfel zugewandte Fläche der Augenlider und die Vorderseite des Augapfels, nicht aber die Hornhaut (.
Neu!!: Epithel und Bindehaut · Mehr sehen »
Biologie
Datei:E.
Neu!!: Epithel und Biologie · Mehr sehen »
Blättermagen
Der Blättermagen (lat. Omasum, auch Buch(magen), Psalter, Kalender oder Löser genannt) ist eine Abteilung der Vormägen der Wiederkäuer.
Neu!!: Epithel und Blättermagen · Mehr sehen »
Blut-Augen-Schranke
Die Blut-Augen-Schranke ist eine physiologische Barriere im Auge, die dessen blutversorgenden uvealen Bereich von der Netzhaut sowie dem Vorderkammer- und Glaskörperraum trennt.
Neu!!: Epithel und Blut-Augen-Schranke · Mehr sehen »
Blut-Hirn-Schranke
Als Blut-Hirn-Schranke, auch Blut-Gehirn-Schranke oder Blut-Hirn-Barriere genannt, wird die selektive physiologische Barriere zwischen den Flüssigkeitsräumen des Blutkreislaufs und dem Zentralnervensystem bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Blut-Hirn-Schranke · Mehr sehen »
Blutgefäß
Blutgefäße des Menschen Als Blutgefäß (lateinisch Vas sanguineum) oder Ader bezeichnet man im menschlichen oder tierischen Körper eine röhrenförmige Struktur, ein Gefäß, in der Blut transportiert wird.
Neu!!: Epithel und Blutgefäß · Mehr sehen »
Brunner-Drüsen
Brunner-Drüsen im Mikroskop Wandbau des Zwölffingerdarms mit Brunner-Drüsen (Schema), aus: ''Gray’s Anatomy'', 20. Auflage, 1918 Die Brunner-Drüsen (Glandulae duodenales), genannt auch Brunnersche Drüsen, sind muköse Drüsen mit verzweigten tubuloalveolären Drüsenschläuchen aus einschichtigem kubischen Epithel, die in die Krypten des Duodenums (Zwölffingerdarm) münden.
Neu!!: Epithel und Brunner-Drüsen · Mehr sehen »
Corpus ciliare
Durchschnitt des menschlichen Augapfels:1. Lederhaut (Sclera)2. Aderhaut (''Chorioidea'')3. Schlemm-Kanal (''Sinus venosus sclerae/Plexus venosus sclerae'')4. Iriswurzel (''Radix iridis'')5. Hornhaut (''Cornea'')6. Regenbogenhaut (''Iris'')7. Pupille (''Pupilla'')8. vordere Augenkammer (''Camera anterior bulbi'')9. hintere Augenkammer (''Camera posterior bulbi'')'''10. Ziliarkörper (''Corpus ciliare'')'''11. Linse (''Lens'')12. Glaskörper (''Corpus vitreum'')13. Netzhaut (''Retina'')14. Sehnerv (''Nervus opticus'')15. Zonulafasern (''Fibrae zonulares'')Äußere Augenhaut (''Tunica externa bulbi''): 1. + 5.'''Mittlere Augenhaut (''Tunica media bulbi''/''Uvea''): 2. + 6. + 10.''' Innere Augenhaut (''Tunica interna bulbi''): 13. Das Corpus ciliare oder der Ziliarkörper (auch Strahlenkörper genannt) ist ein Abschnitt der mittleren Augenhaut.
Neu!!: Epithel und Corpus ciliare · Mehr sehen »
Crusta (Biologie)
Die Crusta ist eine apikale Verdichtung des Zytoplasmas der Deckzellen des Urothels, dem Übergangsepithels der Harnwege.
Neu!!: Epithel und Crusta (Biologie) · Mehr sehen »
Cytoskelett
blau Das Cytoskelett (auch Zytoskelett oder Zellskelett) ist ein aus Proteinen aufgebautes Netzwerk im Cytoplasma eukaryotischer Zellen.
Neu!!: Epithel und Cytoskelett · Mehr sehen »
Darmschleimhaut
Darmschleimhaut-Zellen, vergrößert. Abgesonderter Schleim ist durch rosa Färbung sichtbar gemacht Die Darmschleimhaut (oder Darmmukosa) ist die innere Auskleidung des Darmes.
Neu!!: Epithel und Darmschleimhaut · Mehr sehen »
Desmosom
Schematische Darstellung eines Desmosoms Desmosomen (und), auch Macula adhaerens, sind Zellstrukturen in Zellmembranen, die enge scheibenförmige Verbindungen zwischen zwei Zellen herstellen.
Neu!!: Epithel und Desmosom · Mehr sehen »
Drüse
Schematische Darstellung der Drüsentypen Als Drüse wird in der Anatomie ein Organ bezeichnet, das eine (chemische) Substanz produziert und über Sekretion (wenn sie anderswo im oder am Körper Verwendung findet) oder Exkretion (wenn sie ausgeschieden werden soll) ausschüttet.
Neu!!: Epithel und Drüse · Mehr sehen »
Eierstock
Der paarig angelegte Eierstock – in der medizinischen Fachsprache auch als Ovar (Plural Ovarien) bezeichnet – ist ein weibliches Geschlechtsorgan.
Neu!!: Epithel und Eierstock · Mehr sehen »
Eileiter
Eierstöcken (Ovar) und Vagina. Der Eileiter (auch Ovidukt; Tuba uterina, auch ''Tuba Fallopii'') ist ein paariger Teil der Geschlechtsorgane bei weiblichen Wirbeltieren, welcher als Röhre bzw.
Neu!!: Epithel und Eileiter · Mehr sehen »
Emperipolesis
Mikrofoto von Emperipolesen bei der Rosai-Dorfman-Erkrankung. HE-Färbung. Als Emperipolesis oder Emperipolese wird die Aufnahme oder Umhüllung von zum Beispiel lymphozytären Zellen durch andere Zellen bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Emperipolesis · Mehr sehen »
Endothel
Schematische Darstellung des Endothels mit Astrozyten in der Blut-Hirn-Schranke Als Endothel (lateinisch endothelium) oder Gefäßendothel bezeichnet man die zum Gefäßlumen hin gerichteten Zellen der innersten Wandschicht von Lymph- und Blutgefäßen (Tunica intima).
Neu!!: Epithel und Endothel · Mehr sehen »
Epidermis (Wirbeltiere)
Schichten der Haut Als Epidermis (epi „auf“, „darüber“; derma „Haut“) bezeichnet man die Oberhaut bei Wirbeltieren.
Neu!!: Epithel und Epidermis (Wirbeltiere) · Mehr sehen »
Epithelisierung
Als Epithelisierung (Synonyme: Epithelialisierung, Epithelisation) wird das Überwachsen einer Wunde mit Epithelzellen bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Epithelisierung · Mehr sehen »
Eustachi-Röhre
Zeichnung des Mittelohrs; '''12''': ''Eustachi-Röhre'' Die Eustachi-Röhre, als ''Auditory tube'' bezeichnet, zwischen Cavum Tympani und Nasopharynx auf einer Abbildung aus Gray’s Anatomy Die Eustachi-Röhre (auch Eustachiröhre, Eustachische Röhre oder Eustachi’sche Röhre) oder Ohrtrompete (lat.-anat. Tuba auditiva Eustachii oder Tuba pharyngotympanica) ist eine bei Erwachsenen etwa 3,5–4 Zentimeter lange Röhre, die die Paukenhöhle des Ohrs mit dem Nasenrachenraum (Pars nasalis des Pharynx) verbindet.
Neu!!: Epithel und Eustachi-Röhre · Mehr sehen »
Exkretion
Exkretions-Schema nach Paul Bert, 1881; Legende:'''C''' Blutkreislauf (oder Lymphe), '''D''' Verdauungstrakt, '''E''' Exkretionsöffnung, '''N''' Nervensystem, '''R''' AtmungPaul Bert: ''Leçons de zoologie'' Herausgeber G. Masson, Paris 1881. Als Exkretion („ausscheiden“) wird die Abgabe von überflüssigen Stoffwechselprodukten aus dem Körper an die Umwelt bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Exkretion · Mehr sehen »
Exozytose
Arten der Exozytose Exozytose ist eine Art des Stofftransports aus der Zelle heraus.
Neu!!: Epithel und Exozytose · Mehr sehen »
Extrazelluläre Matrix
Die extrazelluläre Matrix (Extrazellularmatrix, Interzellularsubstanz, EZM;, ECM) ist der Gewebeanteil (vor allem im Bindegewebe), der zwischen den Zellen im sogenannten Interzellularraum liegt.
Neu!!: Epithel und Extrazelluläre Matrix · Mehr sehen »
Flimmerepithel
Elektronenmikroskopische Aufnahme Das Flimmerepithel oder respiratorische Epithel ist eine Schicht aus spezialisierten Epithelzellen, welche den größten Teil der Atemwege auskleidet.
Neu!!: Epithel und Flimmerepithel · Mehr sehen »
Galle
Die Galle (mittelhochdeutsch galle: Gallenblase und deren Inhalt; griechisch χολή cholé; lateinisch fel und bilis) ist eine zähe Körperflüssigkeit, die in der Leber produziert und in der Regel in der Gallenblase gespeichert wird, bevor sie zu den Mahlzeiten in den Zwölffingerdarm (Duodenum) ausgeschüttet wird.
Neu!!: Epithel und Galle · Mehr sehen »
Gallenblase
Die Gallenblase Die Gallenblase (lateinisch Vesica fellea bzw. Vesica biliaris; von lateinisch vesica „Blase“, und fel bzw. bilis „Galle“) ist ein Hohlorgan der Wirbeltiere.
Neu!!: Epithel und Gallenblase · Mehr sehen »
Gelenkkapsel
Die Gelenkkapsel (lateinisch Capsula articularis) ist eine bindegewebige Hülle um echte Gelenke.
Neu!!: Epithel und Gelenkkapsel · Mehr sehen »
Geschmacksknospe
Schematische Darstellung einer Geschmacksknospe Die Geschmacksknospen oder Schmeckknospen (Caliculi gustatorii) sind zwiebelförmige Strukturen in der Mundschleimhaut von Wirbeltieren.
Neu!!: Epithel und Geschmacksknospe · Mehr sehen »
Gewebe (Biologie)
Ein Gewebe oder Zellgewebe ist eine Ansammlung differenzierter Zellen einschließlich ihrer extrazellulären Matrix.
Neu!!: Epithel und Gewebe (Biologie) · Mehr sehen »
Glandula submandibularis
Speicheldrüsen:1 Glandula parotidea2 ''Glandula submandibularis''3 Glandula sublingualis Mikroskopisches Schnittbild der Gl. submandibularis (Hämatoxylin-Eosin-Färbung) Die paarig angelegte Unterkieferspeicheldrüse oder Glandula submandibularis (in der älteren Literatur als Glandula submaxillaris, in der Veterinäranatomie als Glandula mandibularis bezeichnet) ist eine der drei großen Speicheldrüsen.
Neu!!: Epithel und Glandula submandibularis · Mehr sehen »
Haarzelle
Haarzellen oder Haarsinneszellen sind ein Typ von sekundären Sinneszellen (Rezeptoren) im Nervensystem von Wirbeltieren, die mechanische Reize in Nervenaktivität umwandeln.
Neu!!: Epithel und Haarzelle · Mehr sehen »
Harnblase
Harnblase beim Mann und bei der Frau in der Sagittalebene gesehen. Lage der Harnblase und der Harnorgane beim Mann Die Harnblase, Vesica urinaria (daher Fachbegriffe auf Cyst-), ist als Teil des Harntrakts ein Organ bei Tieren und Menschen, in dem der Urin zwischengespeichert wird.
Neu!!: Epithel und Harnblase · Mehr sehen »
Harnleiter
Der Harnleiter (lateinisch Ureter, Plural: Ureteren, Ureter; von altgriechisch οὐρητήρ, ureter.
Neu!!: Epithel und Harnleiter · Mehr sehen »
Harnröhre
Die männliche Harnröhre des Menschen(aus Gray’s Anatomy) Die Harnröhre (lateinisch Urethra, deutsch Harngang; von zu de) ist ein schlauchförmiges Organ des Harn- und Geschlechtsapparats der Säugetiere unter Ausschluss der Kloakentiere.
Neu!!: Epithel und Harnröhre · Mehr sehen »
Hemidesmosom
Hemidesmosomen sind Zellstrukturen in Zellmembranen, die eine Verbindung zwischen Zellen und Basallamina herstellen.
Neu!!: Epithel und Hemidesmosom · Mehr sehen »
Herzbeutel
Der Herzbeutel oder das Perikard (lateinisch Pericardium, latinisierte Form aus altgriechisch περί „herum“ und καρδιά „Herz“; lateinisches Synonym: Theca cordis) ist ein bindegewebiger Sack, der das Herz umgibt und dem Herzen durch eine schmale Gleitschicht freie Bewegungsmöglichkeit gibt.
Neu!!: Epithel und Herzbeutel · Mehr sehen »
Histologie
Vorbereitung einer histologischen Untersuchung im Labor Die Histologie (von und -logie, griechisch λόγος logos „Lehre“) oder Gewebelehre (auch Gewebslehre) ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben.
Neu!!: Epithel und Histologie · Mehr sehen »
Hodenkanälchen
Die Hodenkanälchen oder Samenkanälchen (Tubuli seminiferi) sind der Ort im Hoden, an dem im Rahmen der Spermatogenese die Spermien gebildet werden.
Neu!!: Epithel und Hodenkanälchen · Mehr sehen »
Hornhaut
Die Hornhaut (lateinisch Cornea, eingedeutscht auch Kornea, griechisch keras.
Neu!!: Epithel und Hornhaut · Mehr sehen »
Hypophyse
Epiphyse (rechts) Lage der Hypophyse (Pfeil) MRT (T1, nativ): Der Pfeil zeigt auf die Neurohypophyse (signalintens/hell), der Pfeilkopf auf die Adenohypophyse. Vorder- und Hinterlappen Die Hypophysenhormone Die Hypophyse (auch griechisch-lateinisch Hypophysis cerebri und kurz Hypophysis, von „das unten anhängende Gewächs“) oder Hirnanhangdrüse,, ist eine an der Basis des Gehirns „hängende“, etwa erbsengroße Hormondrüse, die vom Hypothalamus gesteuert wird und der eine zentrale übergeordnete Rolle bei der Regulation des Hormonsystems im Körper zukommt.
Neu!!: Epithel und Hypophyse · Mehr sehen »
Kapillare (Anatomie)
Glomerulus mit gebrochener Blutkapillare TEM-Bild einer Kapillare mit dem Durchmesser 7–8 µm; in der Mitte (schwarz) ein Erythrozyt Kapillaren (Haargefäße) sind in der Anatomie (Histologie) von Menschen und Tieren kleinste Gefäße.
Neu!!: Epithel und Kapillare (Anatomie) · Mehr sehen »
Kolloid
Als Kolloide (von kólla „Leim“ und εἶδος eidos „Form, Aussehen“) oder Kolloiddispersion werden Teilchen oder Tröpfchen bezeichnet, die im Dispersionsmedium (Feststoff, Gas oder Flüssigkeit) fein verteilt sind.
Neu!!: Epithel und Kolloid · Mehr sehen »
Luftröhre
Kehlkopf, Luftröhre und Bronchialsystem Die Luftröhre oder lateinisch Trachea (von;Die Wortbildung ist vom Femininum tracheia abgeleitet. gemeint ist „der raue Schlauch“, „die grobe Arterie“ – im Gegensatz zu den feineren blutführenden Gefäßen) ist bei Wirbeltieren die Verbindung zwischen dem Kehlkopf und dem Bronchialsystem der Lunge.
Neu!!: Epithel und Luftröhre · Mehr sehen »
Lumen (Biologie)
Das Lumen (Pl. Lumina;, ‚Fenster‘) bezeichnet in der Anatomie, Medizin und Medizintechnik den inneren Hohlraum von Hohlorganen und röhrenförmigen Körpern, zum Beispiel der Blutgefäße, des Magens, des Darms und der Harnblase von Säugetieren und im Tracheensystem von Insekten.
Neu!!: Epithel und Lumen (Biologie) · Mehr sehen »
Lungenbläschen
Bronchie, Details der Alveolen und des Lungenkreislaufs Die Lungenbläschen oder Alveolen (von) stellen als Ausstülpungen der Alveolargänge und der Alveolarsäcke das blinde Ende des Respirationstrakts dar und sind die strukturellen Elemente der Lunge, in denen bei der Atmung der Gasaustausch zwischen Blut und Alveolarluft erfolgt.
Neu!!: Epithel und Lungenbläschen · Mehr sehen »
Lysosom
Lysosomen (von λύσις, von lysis ‚Lösung‘, und σῶμα sṓma ‚Körper‘) sind Zellorganellen in eukaryotischen Zellen.
Neu!!: Epithel und Lysosom · Mehr sehen »
Magenschleimhaut
Die Magenschleimhaut (lat. Tunica mucosa gastrica) ist die innere Auskleidung (Schleimhaut) des Magens.
Neu!!: Epithel und Magenschleimhaut · Mehr sehen »
Makropinozytose
Pinozytose Als Makropinozytose (auch Pinozytose) bezeichnet man die Aufnahme von Flüssigkeitsmengen und darin gelösten Substanzen aus dem Umgebungsmedium einer Zelle in ihr Inneres.
Neu!!: Epithel und Makropinozytose · Mehr sehen »
Mechanorezeptoren der Haut
Die Mechanorezeptoren der Haut, auch korpuskuläre Nervenendigungen der Haut oder korpuskuläre Rezeptoren der Haut, sind spezialisierte Rezeptoren auf der Haut, die durch mechanische Reize wie Dehnung und Druck erregt werden.
Neu!!: Epithel und Mechanorezeptoren der Haut · Mehr sehen »
Melanine
Albino-Mutation ohne Melanin Melanine (von „schwarz“) sind in der belebten Natur weit verbreitete dunkelbraune bis schwarze oder gelbliche bis rötliche Pigmente.
Neu!!: Epithel und Melanine · Mehr sehen »
Membran (Trennschicht)
Eine Membran oder Membrane (über spätmittelhochdeutsch membrāne ‚Pergamentstück‘ aus ‚Häutchen‘) ist eine dünne Schicht eines Materials, die den Stofftransport durch diese Schicht beeinflusst.
Neu!!: Epithel und Membran (Trennschicht) · Mehr sehen »
Merkel-Zelle
Schema: Bestandteile der Haut mit Merkel-Zelle (gelb dargestellt) thumbtime.
Neu!!: Epithel und Merkel-Zelle · Mehr sehen »
Mikroplicae
Bei Mikroplicae (griechisch-lateinisch für „kleine Falten“) handelt es sich um schmale Auffaltungen der Zellmembran, die entweder am apikalen Pol oder seitlich zwischen Epithelzellen zu finden sind.
Neu!!: Epithel und Mikroplicae · Mehr sehen »
Mikrovilli
Mikrovilli Mikrovilli (Einzahl: Mikrovillus, von lateinisch villus ‚Zotte‘) sind fadenförmige Zellfortsätze, die zur Oberflächenvergrößerung von Zellen und der Verbesserung des Stoffaustausches dienen.
Neu!!: Epithel und Mikrovilli · Mehr sehen »
Milchdrüse
Schematischer Querschnitt durch die weibliche Brust: 1. Brustkorb mit Rippen, 2. großer Brustmuskel, 3. Brustdrüse, 4. Brustwarze, 5. Warzenhof, 6. Milchgänge, 7. Fettgewebe, 8. Haut Als Milchdrüse (lateinisch Glandula mammaria, von mamma „Zitze, Euter, weibliche Brustdrüse“; griech. μαστός, mastos) bezeichnet man die aus der Milchleiste hervorgehenden Drüsenkörper von Säugetieren, die während der Laktation Milch zur Ernährung des säugenden Nachwuchses bilden und abgeben können.
Neu!!: Epithel und Milchdrüse · Mehr sehen »
Mundhöhle
Sagittalschnitt durch den Mund Mundvorhof mit Umschlagfalte Mundhöhle eines Erwachsenen Die Mundhöhle ist der Raum, der nach vorne durch die Lippen, nach oben durch den harten und weichen Gaumen, der sie von der Nasenhöhle trennt, seitlich durch die Wangen und nach unten durch den Mundboden begrenzt ist.
Neu!!: Epithel und Mundhöhle · Mehr sehen »
Muskulatur
Die Muskulatur der Brust (Zeichnung von Bernardino Genga ''Anatomia per uso et intelligenza del disegno ricercata non solo su gl’ossi, e muscoli del corpo humano'') Muskeln des Menschen (Bildtafel aus der 4. Auflage von ''Meyers Konversations-Lexikon'' (1885–1890)) Sportstudenten der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK), Leipzig, April 1956 Die Muskulatur ist ein Organsystem in Gewebetieren und bezeichnet eine Gesamtheit von Muskeln.
Neu!!: Epithel und Muskulatur · Mehr sehen »
Nebenhoden
Hoden und Nebenhoden:2 Nebenhodenkopf (''Caput epididymidis'')4 Nebenhodenkörper (''Corpus epididymidis'')5 Nebenhodenschwanz (''Cauda epididymidis'') Katers:1 Kopfende des Hodens 2 Schwanzende des Hodens 3 Nebenhodenrand 4 freier Rand 5 Hodengekröse '''6 Nebenhoden''' 7 Geflecht der Hodenarterie und -vene 8 Samenleiter Unter dem Nebenhoden (Epididymis, Plural Epididymides, „an, bei, auf“ und dídymos „doppelt, Zwilling“) versteht man ein dem Hoden aufliegendes Geschlechtsorgan, das hauptsächlich aus dem auf engstem Raum stark gewundenen, insgesamt 4 bis 6 m langen Nebenhodengang (Ductus epididymidis) besteht.
Neu!!: Epithel und Nebenhoden · Mehr sehen »
Nervengewebe
Das Nervengewebe ist eines der vier Grundgewebe von Gewebetieren, zu denen neben anderen die Wirbeltiere gehören und so auch der Mensch.
Neu!!: Epithel und Nervengewebe · Mehr sehen »
Netzhaut
Mittlere Augenhaut (''Tunica media bulbi''): 2. + 6. + 10. Innere Augenhaut (''Tunica interna bulbi''): 13. Die Netzhaut oder Retina (von ‚Netz‘), auch Innere Augenhaut (Tunica interna bulbi) genannt, ist das mehrschichtige spezialisierte Nervengewebe, das die Innenseite der Augenwand bei Wirbeltieren sowie einigen Tintenfischen und Schnecken auskleidet.
Neu!!: Epithel und Netzhaut · Mehr sehen »
Netzmagen
Mägen eines Schafes von links. 1–13 Pansen, 14 Pansen-Netzmagen-Furche, 15 Netzmagen, 16 Labmagen, 17 Speiseröhre, 18 Milz. Der Netzmagen (oder die Haube, lat. Reticulum) ist der am weitesten vorn gelegene Abschnitt des Magens der Wiederkäuer.
Neu!!: Epithel und Netzmagen · Mehr sehen »
Neuroepithel
Als Neuroepithel wird das dicke mehrreihige Epithel der Neuralplatte beziehungsweise des daraus abgefalteten Neuralrohrs bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Neuroepithel · Mehr sehen »
Nierenbecken
Schema der Niere mit Nierenbecken (englisch ''renal pelvis'') Als Nierenbecken (lateinisch Pelvis renalis, griechisch Pyelos) bezeichnet man das trichterförmig erweiterte obere Ende des Harnleiters, das als Sammeltrichter für den Urin aus den Sammelrohren dient.
Neu!!: Epithel und Nierenbecken · Mehr sehen »
Ohrspeicheldrüse
Speicheldrüsen:1 ''Glandula parotidea''2 Glandula submandibularis3 Glandula sublingualis Ausführungsöffnung der Ohrspeicheldrüse: Papilla parotidea Die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotidea, auch Glandula parotis oder kurz Parotis) ist bei höheren Wirbeltieren die größte Speicheldrüse im Kiefer-Mund-Bereich.
Neu!!: Epithel und Ohrspeicheldrüse · Mehr sehen »
Ovarialfollikel
Unter einem Ovarialfollikel oder Eierstockfollikel (auch Eifollikel oder Eibläschen) versteht man die Einheit aus Eizelle und den sie umgebenden Hilfszellen im Eierstock (Ovarium).
Neu!!: Epithel und Ovarialfollikel · Mehr sehen »
Pansen
Der Pansen (lat. pantex, über frz. panse „Wanst“; anatomisch Rumen, in der Jägersprache Weidsack) ist ein Hohlorgan bei Wiederkäuern (Ruminantia) und der größte der drei Vormägen.
Neu!!: Epithel und Pansen · Mehr sehen »
Phagocytose
Phagocytose (von und), eingedeutscht auch Phagozytose, bezeichnet die aktive Aufnahme von Partikeln (bis zu kleineren Zellen) in eine einzelne eukaryotische Zelle.
Neu!!: Epithel und Phagocytose · Mehr sehen »
Pleura
Das Lungenparenchym ist umgeben von einer pulmonalen und viszeralen Bindegewebsschicht der Pleura. Dazwischen liegt ein dünner Flüssigkeitsspalt, die Pleurahöhle; Adhäsionkräfte sorgen für den gleitfähigen Zusammenhalt beider Blätter Die Pleura (von, ‚Rippe‘), deutsch Brustfell, ist eine dünne seröse Haut in der Brusthöhle.
Neu!!: Epithel und Pleura · Mehr sehen »
Prostata
Gray, vor 1858) Prostata und Samenblasen Die Prostata (von ‚Vorsteher‘, ‚Vordermann‘) oder Vorsteherdrüse ist bei allen männlichen Säugetieren zum einen eine akzessorische Geschlechtsdrüse zur Herstellung eines Teils der Spermaflüssigkeit und zum anderen ein Muskelkomplex zur Kanalumschaltung zwischen Blasenleerung und Ejakulation.
Neu!!: Epithel und Prostata · Mehr sehen »
Resorption
Resorption (‚herunterschlucken‘; PPP: resorptum → resorptio ‚das Herunterschlucken‘) bezeichnet die Stoffaufnahme in biologischen Systemen.
Neu!!: Epithel und Resorption · Mehr sehen »
Rezeptorzelle
Als Rezeptorzelle oder Rezeptor (von ‚aufnehmen‘, ‚empfangen‘), Sensor oder Sensorzelle, auch Sinneszelle, wird in der Physiologie eine spezialisierte Zelle bezeichnet, die bestimmte chemische oder physikalische Reize aus der Umgebung eines Körpers oder seinem Inneren aufnimmt und in eine neuronal vergleichbare Form überführt (transduziert).
Neu!!: Epithel und Rezeptorzelle · Mehr sehen »
Riechschleimhaut
Geruchsrezeptor Die Riechschleimhaut oder das Riechepithel, auch Regio olfactoria genannt, enthält die Sinneszellen des Geruchssinns.
Neu!!: Epithel und Riechschleimhaut · Mehr sehen »
Samenleiter
Lage des Samenleiters (Spermienleiters) Der Samenleiter (oder de), auch Spermienleiter genannt, verbindet bei männlichen Wirbeltieren beidseits den Nebenhoden mit der Harnröhre und dient der Weiterleitung der Spermien.
Neu!!: Epithel und Samenleiter · Mehr sehen »
Schilddrüse
Schilddrüse und Nebenschilddrüsen beim Menschen Die Schilddrüse (W. His: Die anatomische Nomenclatur. Nomina Anatomica. Der von der Anatomischen Gesellschaft auf ihrer IX. Versammlung in Basel angenommenen Namen. Verlag Veit & Comp, Leipzig 1895.F. Kopsch: Die Nomina anatomica des Jahres 1895 (B.N.A.) nach der Buchstabenreihe geordnet und gegenübergestellt den Nomina anatomica des Jahres 1935 (I.N.A.). 3. Auflage. Georg Thieme Verlag, Leipzig 1941.H. Stieve: Nomina Anatomica. Zusammengestellt von der im Jahre 1923 gewählten Nomenklatur-Kommission, unter Berücksichtigung der Vorschläge der Mitglieder der Anatomischen Gesellschaft, der Anatomical Society of Great Britain and Ireland, sowie der American Association of Anatomists, überprüft und durch Beschluß der Anatomischen Gesellschaft auf der Tagung in Jena 1935 endgültig angenommen. 4. Auflage. Verlag Gustav Fischer, Jena 1949.International Anatomical Nomenclature Committee: Nomina Anatomica. Spottiswoode, Ballantyne and Co., London/ Colchester 1955. oder Glandula thyroideaFederative Committee on Anatomical Terminology (FCAT): Terminologia Anatomica. Thieme, Stuttgart 1998.) ist eine Hormondrüse bei Wirbeltieren, die sich bei Säugetieren am Hals unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre befindet.
Neu!!: Epithel und Schilddrüse · Mehr sehen »
Schleimbeutel
Schleimbeutel am Knie, zu sehen oben rechts, Mitte rechts und unten rechts Ein Schleimbeutel oder Gleitbeutel,, ist ein kleines flüssigkeitsgefülltes Säckchen, das im Bereich des Bewegungsapparats an Stellen mit erhöhter mechanischer Druckbelastung vorkommt.
Neu!!: Epithel und Schleimbeutel · Mehr sehen »
Schweißdrüse
Als Schweißdrüsen (lateinisch Glandulae sudoriferae) werden besondere Hautdrüsen bezeichnet, die ein wässriges Sekret abgeben.
Neu!!: Epithel und Schweißdrüse · Mehr sehen »
Sekretion
Als Sekretion (lateinisch secretio „Absonderung“; Verb dazu ist sezernieren, von lateinisch secernere „absondern“) oder Absonderung wird die Abgabe von flüssigen Stoffen, die (im Gegensatz zum Exkret bei der Exkretion) eine bestimmte Funktion erfüllen, durch einzelne Zellen oder Drüsen bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Sekretion · Mehr sehen »
Speicheldrüse
Speicheldrüsen:1 Glandula parotidea2 Glandula submandibularis3 Glandula sublingualis Eine Speicheldrüse ist eine exokrine Drüse, die Speichel (Saliva) bildet und damit die Gleitfähigkeit zum Abschlucken des Bissens gewährleistet.
Neu!!: Epithel und Speicheldrüse · Mehr sehen »
Speiseröhre
Übersicht über den menschlichen Verdauungstrakt, Speiseröhre rot hervorgehoben. Die Speiseröhre oder der Ösophagus (eingedeutscht von lateinisch Oesophagus, von), veraltet Schluckdarm, ist ein muskulöser Schlauch, der außen von Bindegewebe umgeben und innen mit Schleimhaut ausgekleidet ist.
Neu!!: Epithel und Speiseröhre · Mehr sehen »
Stammzelle
Menschliche embryonale Stammzellen. A: undifferenzierte Kolonien. B: Neuron-Tochterzelle Als Stammzellen werden allgemein Körperzellen bezeichnet, die sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können.
Neu!!: Epithel und Stammzelle · Mehr sehen »
Swiss Institute of Bioinformatics
name.
Neu!!: Epithel und Swiss Institute of Bioinformatics · Mehr sehen »
Talgdrüse
Haar mit Talgdrüse.1) Haar 2) Hautoberfläche (''Stratum corneum'') 3) Talg 4) Talgdrüse 5) Follikel Die Talgdrüsen (lateinisch Glandulae sebaceae) sind ca.
Neu!!: Epithel und Talgdrüse · Mehr sehen »
Tight Junction
Schematische Darstellung einer Tight Junction Elektronenmikroskopische Gefrierbruchaufnahme der Tight Junctions der Blut-Hirn-Schranke einer Ratte Tight Junctions (engl. für „dichte Verbindung“, lat. Zonula occludens, in deutscher Literatur auch „Schlussleiste“) sind schmale Bänder aus Membranproteinen, die Epithelzellen von Wirbeltieren vollständig umgürten und mit den Bändern der Nachbarzellen in enger Verbindung stehen.
Neu!!: Epithel und Tight Junction · Mehr sehen »
Transport (Biologie)
Der Transport von Stoffen, Energie und Information ist für Lebewesen die Voraussetzung, ihren komplexen Stoffwechsel und andere Lebensvorgänge zu koordinieren und aufrechtzuerhalten.
Neu!!: Epithel und Transport (Biologie) · Mehr sehen »
Transporter (Membranprotein)
Transporter (auch: Carrier) sind membranständige Transportproteine, deren Haupt-Transportprozess durch eine Konformationsänderung mit dem Einfachtransport (Carrier oder Permeasen für den Uniport; Beispiel: GLUT1) eines Soluts oder mit einem zweiten Transportprozess (Symport, Antiport; Beispiel: SGLT1) gekoppelt ist.
Neu!!: Epithel und Transporter (Membranprotein) · Mehr sehen »
Tränendrüse
'''Tränenapparat:''' a.
Neu!!: Epithel und Tränendrüse · Mehr sehen »
Tubulus
Die Abbildung zeigt die verschiedenen Abschnitte des Tubulussystems. Der Tubulus (Plural Tubuli, Adjektiv tubulär), anatomisch exakt: Nierentubulus, lateinisch Tubulus renalis, oder Nierenkanälchen, genannt auch Nierenröhrchen, Harnkanälchen oder Tubulusapparat, ist das sich an das Nierenkörperchen anschließende Gangsystem und bildet mit diesem zusammen das Nephron als kleinste funktionelle Einheit der Niere von Menschen und anderen Säugetieren.
Neu!!: Epithel und Tubulus · Mehr sehen »
Tunica serosa
Als Tunica serosa (auch Serosa) bezeichnet man die glatte Auskleidung der Brusthöhle (Cavitas pleuralis), Bauchfellhöhle (Cavitas peritonealis), des Herzbeutels (Cavitas pericardialis) und des Hodensacks (Cavitas serosa scroti).
Neu!!: Epithel und Tunica serosa · Mehr sehen »
Urin
Harnwege des Mannes Der Urin (altgriechisch οὖρον oúron), auch Harn genannt, ist ein flüssiges bis pastöses Ausscheidungsprodukt der Wirbeltiere.
Neu!!: Epithel und Urin · Mehr sehen »
Urothel
Schleimhaut der Harnblase mit Urothel Als Urothel (auch Übergangsepithel) bezeichnet man das mehrschichtige Deckgewebe (Epithel) der ableitenden Harnwege (Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, oberer Teil der Harnröhre).
Neu!!: Epithel und Urothel · Mehr sehen »
Ussing-Kammer
Das Prinzip der Ussing-Kammer nach Hans Ussing: (1) Das Epithelgewebe halbiert die Kammer. (2) Halbzellen mit Ringerlösung (3)(4) Agar-Ringer-Brücken (5) Gesättigte KCl-AgCl-Lösung (6) Variable Gleichstromquelle (7) Amperemeter (8) Gesättigte KCl-Kalomel-Elektrode (9) Voltmeter Die Grundlagen des Membran-Potentials Die Ussing-Kammer ist eine Apparatur zur Messung von Eigenschaften der Durchlässigkeit von Epithelgeweben.
Neu!!: Epithel und Ussing-Kammer · Mehr sehen »
Vagina des Menschen
Die menschliche Vagina im Verhältnis zu den übrigen Geschlechtsorganen Die Vagina des Menschen, auch Scheide genannt, ist ein mit Schleimhäuten ausgekleidetes, primäres, inneres Geschlechtsorgan der Frau.
Neu!!: Epithel und Vagina des Menschen · Mehr sehen »
Verhornung
Als Verhornung (Keratinisierung) bezeichnet man den Vorgang der Umbildung von Epithelzellen über hornbildende Zellen (Keratinozyten) zu Hornzellen (Korneozyten).
Neu!!: Epithel und Verhornung · Mehr sehen »
Vielzeller
fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme. Vielzeller oder Mehrzeller sind Lebewesen, die aus mehreren Zellen aufgebaut sind.
Neu!!: Epithel und Vielzeller · Mehr sehen »
Würfel (Geometrie)
Der Würfel (von deutsch werfen, weil er in Würfelspielen geworfen wird; auch regelmäßiges Hexaeder, von griech. hexáedron ‚Sechsflächner‘, oder Kubus, von bzw. lat. cubus ‚Würfel‘) ist einer der fünf platonischen Körper, genauer ein dreidimensionales Polyeder (Vielflächner) mit.
Neu!!: Epithel und Würfel (Geometrie) · Mehr sehen »
Zelle (Biologie)
prokaryotischen Einzeller: ''Bacillus subtilis'' Paramecium aurelia'' Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit aller Organismen.
Neu!!: Epithel und Zelle (Biologie) · Mehr sehen »
Zellkern
Ein Zellkern oder Nukleus („Kern“) ist ein im Cytoplasma gelegenes, meist rundlich geformtes Organell der eukaryotischen Zelle, welches das Erbgut enthält.
Neu!!: Epithel und Zellkern · Mehr sehen »
Zellkontakt
Als Zellkontakte oder Zellverbindungen (engl. Cell junctions) werden die direkten Berührungsstellen von Zellen in Geweben bezeichnet.
Neu!!: Epithel und Zellkontakt · Mehr sehen »
Zellpolarität
Schema einer Epithelzelle. Als Zellpolarität bezeichnet man in der Biologie eine polare Morphologie einer Zelle, also eine spezifische Ausrichtung von Zellstrukturen.
Neu!!: Epithel und Zellpolarität · Mehr sehen »
Zwölffingerdarm
Verdauungsapparat des Menschen Der Zwölffingerdarm, lateinisch Duodenum, ist der erste kurze Abschnitt des Dünndarms.
Neu!!: Epithel und Zwölffingerdarm · Mehr sehen »
Leitet hier um:
Drüsenepithel, Epithelgewebe, Epithelial, Epithelien, Epithelzelle, Epithelzellen, Haftkomplex, Plattenepithel, Zylinder-Epithel, Zylinderepithel.
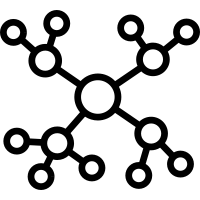
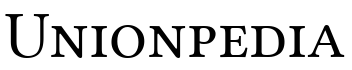

 Schneller Zugriff als Browser!
Schneller Zugriff als Browser!